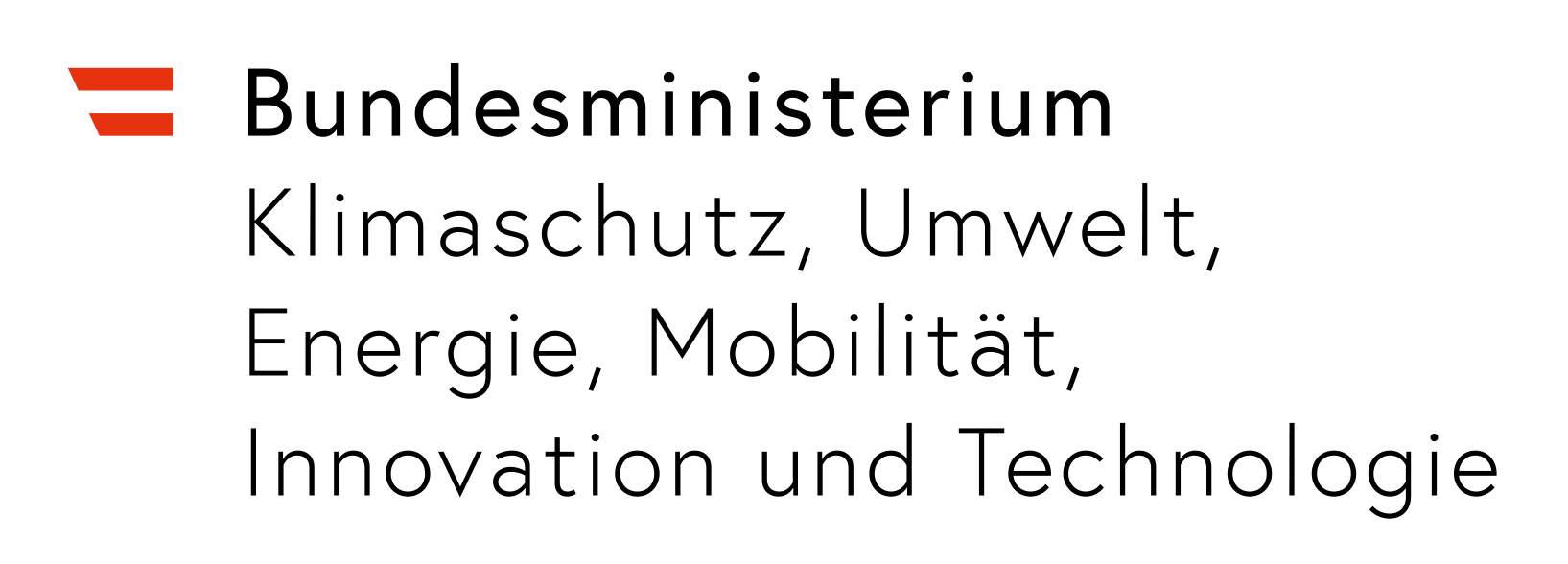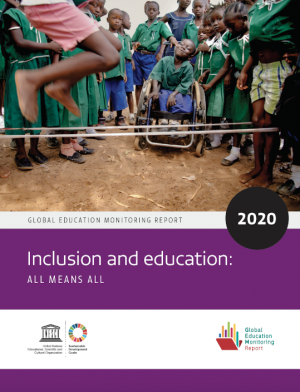
Der diesjährige Weltbildungsbericht der UNESCO ist unter dem Titel „Für alle heißt für alle“ mit Fokus auf Inklusion in der Bildungsarbeit erschienen.
Sara Fend vom Instituto Paulo Freire Austria fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen:
Begriff „Inklusion“ soll breiter gefasst werden.
Der Bericht bestätigt, dass weltweit, jedoch besonders in Ländern mit niedrigem Einkommen Identität, Herkunft und Fähigkeiten die Bildungschancen bestimmen. Die Hintergründe von Ausgrenzung und Benachteiligung im Schulsystem sind oft unterschiedlich, die Diskriminierungsmechanismen und Auswirkungen für die Betroffenen jedoch sehr ähnlich: Die Wahrscheinlichkeit, dass Geflüchtete keine weiterführende Schule besuchen, ist dreimal höher als für Einheimische. Dass Kinder mit Behinderungen gar keine Schule besuchen, ist zweieinhalbmal wahrscheinlicher als bei nicht behinderten Kindern . In mindestens 20 Ländern schließt keine einzige Frau im ländlichen Raum eine weiterführende Schule ab. Diese Zahlen zeigen, dass der Begriff der Inklusion sehr breit gefasst werden muss und Maßnahmen mehreren Formen der Benachteiligung gleichzeitig entgegenwirken sollten.
Lehrende und Lehrbücher spielen eine große Rolle.
Ein klarer Ansatzpunkt ist die Aus- und Weiterbildung von Lehrenden. „Alle Lehrerinnen und Lehrer sollten darauf vorbereitet sein, alle Kinder unterrichten zu können“ , fasst Antoninis zusammen. Mit entsprechender Qualifikation sollte es ihnen leichter fallen, die Vorteile von Vielfalt zu erkennen und für den Unterricht zu nützen . Auch ein vielfältigerer Lehrkörper selbst würde Inklusion fördern.
Doch auch Schulbücher spielen eine wichtige Rolle. Texte und Bilder sollten frei von Stereotypem gestaltet sein. Jedes Kind sollte sich in einem Schulbuch wiedererkennen können. Für Antoninis gehören diversifizierte Schulbücher und Lehrpläne genauso zum „universellen Design“ dazu, das derzeit vor allem im Sinne der physischen Barrierefreiheit umgesetzt wird. Die Unterrichtssprache erschwert vor allem indigenen Kindern den Zugang zu Bildung. Schnell kann der Eindruck entstehen, ihre Muttersprache sei weniger wert und sie erfahren dadurch Ausgrenzung.
Mit Behinderung in regulärer Schule.
Dass Inklusion möglich ist, zeigte die Lehrassistentin und Aktivistin Brina Maxino, die mit Down-Syndrom ihre Ausbildung von der Schule bis zur Universität in regulären Institutionen abgeschlossen hat. „Ich musste mich mehr anstrengen als die anderen, weil ich langsamer war“, erzählte sie, „doch mit der Unterstützung meiner Familie und engagierter Lehrender habe ich es geschafft.“ Der Weltbildungsbericht spricht auch die allgemein mangelnde Überzeugung von Lehrenden und Eltern an, dass Inklusion in der Bildung möglich und wünschenswert ist. Viele Eltern denken, dass Kinder mit Behinderungen in der Klasse den Lerneffekt ihres Kindes negativ beeinflussen würden, umgekehrt sehen Eltern von Kindern mit Behinderungen ihre Kinder in regulären Schulen oft nicht gut aufgehoben und lassen sie von regulären Schulen in Sonderschulen wechseln. Dabei könne der Austausch zwischen Lehrenden und Eltern, untereinander und zwischenseitig helfen.
Gesetze anpassen und Daten erheben.
Auch Politik spielt eine wichtige Rolle: Ein Viertel aller Länder schreibt vor, Menschen mit Behinderungen in getrennten Systemen auszubilden. In den meisten Ländern gibt es sowohl getrennte als auch gemeinsame Schulen. Ein weiterer Faktor ist die offizielle Anerkennung der Gebärdensprache, wie das zurzeit in nur 41 Ländern der Fall ist.
Um effiziente Maßnahmen zu ermöglichen, möchte der Bericht auch zu mehr Datenerhebung aufrufen. Gerade in Nordafrika und Westasien sei die Datenlage lückenhaft. Ausreichende Daten und Transparenz könnten nicht nur gezieltere finanzielle Unterstützung seitens des Staates bewirken, sondern auch Nichtregierungsorganisationen ermöglichen, Aktivitäten der Regierungen im Bereich der Inklusion zu überprüfen und Lücken zu füllen. Bei der Datenerhebung müsse darauf geachtet werden, stigmatisierende Kategorien zu vermeiden – zum Zwecke der respektvollen Datenerhebung gegenüber Menschen mit Behinderungen wurden bereits spezielle Fragebögen entwickelt.
Inklusion angesichts Corona umso wichtiger.
Helen Clark, ehemalige Primierministerin von Neuseeland und Vorsitzende des Beratungsgremiums des Weltbildungsberichts, betonte den Einfluss von COVID-19 auf Bildung: Viele Kinder gingen in dieser Zeit nicht zur Schule und würden vielleicht gar nicht zurückkehren, weil sie nun arbeiten müssen. Antoninis ist überzeugt, dass die teilweise angebotene Fernlehre online auf Dauer nicht die Schule ersetzen kann. Man müsse auch mitbedenken, dass in den von der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) als „am wenigsten entwickelte Länder“ eingestufte Nationen nur zwölf Prozent der Haushalte über eine Internetverbindung verfügen. „Die Pandemie verschlimmerte die Ausgrenzung derer, die bereits an den Rand gedrängt waren“, so Clark. Abschließend bekräftigte sie: „Die Botschaft des Berichts hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können.“
Quelle: Instituto Paulo Freire Austria