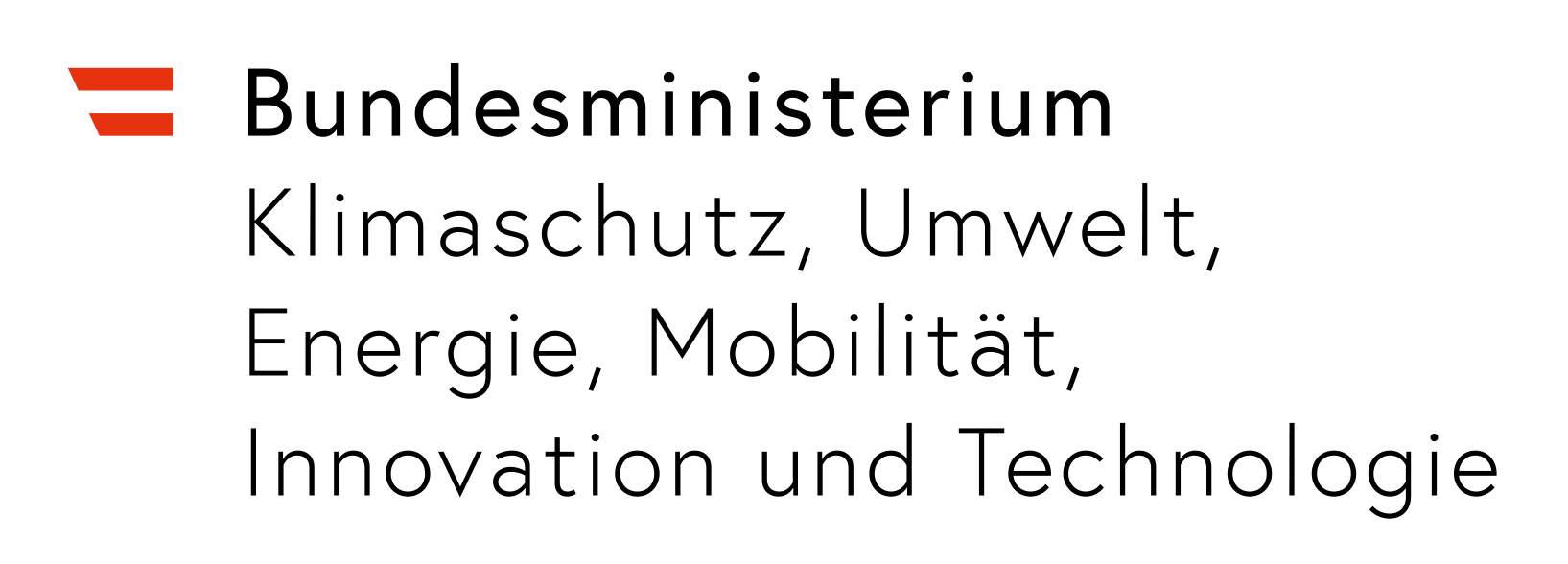Gastkommentar von Brita Krucsay und Magdalena Heuwieser
Jetzt hat sie es doch getan. Nachdem es den Anschein hatte, als wäre die kurze Debatte um die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geplante Umbenennung des EU-Ressorts für Migrations- und Asylagenden in „Schutz der europäischen Lebensweise“ nach ein paar Schlagzeilen und Kommentaren endgültig und spurlos verebbt, beschloss die designierte EU-Präsidentin eine Änderung: Das Ressort erhält nun den Titel „Förderung der europäischen Lebensweise“. Auch die vormals kritischen EU-Fraktionen sind damit zufrieden – Förderung statt Schutz suggeriere nun nicht mehr eine Bedrohung Europas durch Migration, und an den positiven Werten der EU herrsche ja kein Zweifel.
Mit gesellschaftlichen Werten ist das allerdings so eine Sache: Als Vorgaben auf dem Papier stoßen sie auf allgemeine Akzeptanz. Für das Gute und gegen das Böse zu sein, ist mehrheitsfähig. Haarig wird es freilich bei der Frage nach der Praxis. Denn ganz ehrlich: Inwieweit lassen sich heute konkrete machtpolitische Strategien und damit verwobene gesellschaftliche Praxen und Lebensweisen durch hehre Werte legitimieren? Eine solche argumentative Verbindung kann mitunter gewaltige inhaltliche Verrenkungen erfordern, die nur mit blickdichten Scheuklappen gelingen.
Lebensweise als Gesamtheit der Verhältnisse
Wenn also die im Vertrag von Lissabon festgeschriebenen Grundwerte der EU – „Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören“ – herangezogen werden, um die neue Ressortbezeichnung zu legitimieren, klingt das zwar gut, ist aber eine Themenverfehlung. Denn gefördert werden sollen nicht die „europäischen Werte“, sondern die „europäische Lebensweise“. Europäische Lebensweise? Dirndl, Salami, Sangría – oder geht’s da um etwas anderes? Ja, allerdings: Die Lebensweise umfasst die Gesamtheit der Verhältnisse, in denen eine Gesellschaft ihre Produktion und ihren Konsum organisiert. Und dementsprechend konfrontieren Migration und Flucht die EU auch mit der unangenehmen Tatsache, dass deren Reichtum auf der Ausbeutung von Mensch und Natur beruht – und dass die Auslagerung der damit verbundenen Probleme an ihre Grenzen gerät. Die europäische Lebensweise ist weltweit nicht verallgemeinerbar – sie ist eine imperiale Lebensweise.
Imperiale Lebensweise
So etwa importiert Europa ein Viertel aller landwirtschaftlichen Rohstoffe aus illegaler Entwaldung des Regenwaldes, davon 27 Prozent der gesamten Sojabohnen, 18 Prozent des gesamten Palmöls, 15 Prozent des gesamten Rindfleischs und 31 Prozent des gesamten Leders. Zur Veranschaulichung: Alle zwei Minuten wird für den europäischen Markt die Fläche eines Fußballfeldes vernichtet. In Relation zur Bevölkerungsgröße hat Europa damit pro Person den weltweit größten Anteil an der Abholzung des Regenwaldes. Unvorstellbar, wie viele Menschen und Tiere auf diese Weise ihr Leben oder ihren unmittelbaren Lebensraum verlieren und welche globalen Auswirkungen auf die Klimakatastrophe die Eliminierung des Regenwaldes hat. Deswegen sorgen die politisch Verantwortlichen und Profiteure dafür, dass wir es uns gar nicht erst vorstellen, sondern dass der Markt unsere Weltsicht begrenzt und ständig wachsender Konsum als natürliches Grundbedürfnis erscheint. Denn nur so kann es funktionieren, dass zwar alle wissen, was geschieht, aber trotzdem weitertun. Und nur so kann es legitim erscheinen, Kritiker des Mercosur-Paktes pauschal als „Nörgler und Verhinderer“ zu diskreditieren, wie etwa Michael Löwy von der Industriellenvereinigung jüngst in einem Gastkommentar im „Standard“.
Wenn die Achtung der Menschenwürde dort aufhört, wo der Profit beginnt und Menschen deswegen in Fabriken gnadenlos ausgebeutet werden; wenn Freiheit ernsthaft mit der freien Wahl des Fleischkonsums gleichgesetzt wird, ohne dass es irgendjemanden interessiert, wie viel Regenwald für Futtermittel niedergebrannt wurde; wenn Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Freihandelsabkommen an Schiedsgerichte verhökert werden; und wenn Menschenrechte nicht für jene gelten, deren Lebensgrundlagen vernichtet werden, um den europäischen Alltagskomfort zu sichern, dann ist es mit der Umsetzung der europäischen Werte nicht weit her.
Ein Schnitt ins eigene Fleisch
Wir lagern mit unserer Lebensweise Kosten auf andere aus – Menschen im globalen Süden, billigste Arbeitskräfte, Ökosysteme und zukünftige Generationen. Erweitern wir die Perspektive über den Tellerrand hinaus, so wird deutlich, dass diese Lebensweise weder auf Dauer „geschützt“ noch „gefördert“ werden kann. Selbst wer weiter egoistisch nur an Europa denken will, sollte merken, dass wir uns ins eigene Fleisch schneiden: Die unendliche Beschleunigung, der Wachstumszwang, der Wettbewerb, die Versklavung durch Konsum und die aus alldem resultierende Klimakrise, in der wir mittendrin sind, verschlechtern ganz konkret unser eigenes Leben und das unserer Kinder. Erweitern wir die Perspektive, wird deutlich, dass die europäische imperiale Lebens- und Produktionsweise von einem „guten Leben“ weit entfernt ist.
Diese Diskussion ist (nicht nur) im EU-Parlament zu führen. Es gilt nicht, die schönsten Begriffe zu finden, sondern um Inhalte zu ringen. Es gilt, Strukturen zu schaffen, die wir mit Leben füllen können, die tragfähig und global verallgemeinerbar sind. Statt eine Lebensweise zu fördern, die auf Ausbeutung gründet und unweigerlich zu weiterer gesellschaftlicher Spaltung führt, könnten wir uns dann tatsächlich der praktischen Umsetzung unserer Werte widmen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem „Ressort für die Etablierung einer solidarischen Lebensweise“?
Autorinnen:
Brita Krucsay ist Soziologin.
Magdalena Heuwieser hat Internationale Entwicklung studiert.
Im Rahmen des Kollektivs „Imperiale Lebensweise und solidarische Alternativen“ sind sie Mitautorinnen der Broschüre „Von A wie Arbeit bis Z wie Zukunft. Arbeiten und Wirtschaften in der Klimakrise“, die soeben erschienen ist.
Quelle: Wiener Zeitung